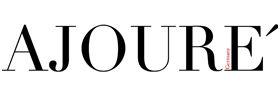Ok, ich gebe es zu. Ich habe gelogen. An einem Abend vor nicht allzu langer Zeit hatte ich zwei Einladungen. Eine davon war schon sehr alt gewesen und dadurch hatte ich sie total verschwitzt, hätte sie aber gerade deswegen der Anderen vorziehen müssen. Wollte ich aber nicht. Also gab ich vor, nicht in der Stadt zu sein. Und litt kurz darauf unter Panikschweiß, als meine Freundin am Abend ihr Smartphone auspackte, um der Welt von unserem Kochabend zu berichten. Bei mir.
Angesichts dieser Situation habe ich mich gefragt, ob man in Zeiten dauerpräsenter Social Media überhaupt noch untertauchen kann? Klar steht einem immer frei, das Handy auszuschalten und die Bettdecke über den Kopf zu ziehen, aber ich rede davon, dass man manchmal Verabredungen hat, von denen nicht jeder etwas erfahren soll. Bei einem Treffen zu zweit ist das nicht allzu schwierig, denn man kann die Person bitten, einen nicht zu taggen und damit der Öffentlichkeit auszuliefern, aber wie schaut es aus, wenn man an einem Tisch im Restaurant sitzt und zwanzig Leute ihr Essen fotografieren? Geht man dann einzeln herum und erklärt sein unangenehmes Anliegen? Wohl eher nicht.
Ich bin gar kein Freund dieser unglaublichen Transparenz. Vielleicht gerade, weil ich viel mit der Öffentlichkeit arbeite und mir sowieso schon in die (Gefühls-)Karten gucken lasse, indem ich schreibe und das eine breite Masse lesen kann. Aber das ist mein Beruf und der macht mir unglaublich viel Spaß. Dadurch trennt sich für mich allerdings Social Media in den beruflichen und privaten Bereich. Was ich schreibe, ist selbstverständlich vorher gefiltert, das ist ungefähr so, wie ins Fitnessstudio zu rennen, bevor man sich an den Strand legt. Man hübscht sich auf. Ich hübsche meine Gedanken auf inklusive den Fotos.
Und deswegen bin ich wohl empfindlich, wenn ich nach einem schönen Abendessen mit Freunden online gehe und sehe, dass auf meiner Pinnwand schon seit fünf Stunden zu lesen ist, wo und mit wem ich mich befinde. Das ist schon beängstigend, wenn man sich mal vorstellt, dass es Menschen gibt, die das virtuelle Stalken auch gerne mal ins reale Leben übertragen. Und wenn mir eine Freundin erzählt, dass sie erst letzten Sonntag in einem tollen neuen Restaurant war, das ich unbedingt ausprobieren müsse, dann sage ich oftmals etwas beklemmt „ja, ich weiß“ und fühle mich wie ein perverser Voyeur.
Was soll man machen, wenn die Informationen auf dem Silbertablett serviert werden, inklusive Garnierung, sprich die Gesellschaft und Bewirtung gleich dazu? Ausblenden, ignorieren, so tun als ob man es nie gesehen hätte… oder doch munter weiter stalken? Ich bin mir da sehr unsicher. Denn wir alle, die wir eher in unserem Profil wohnen als zu Hause und unsere künstlerische Seite ausleben, indem wir verschiedene Farbfilter bei Instagram ausprobieren, sind kleine Möchtegern-VIPs. Wir zeigen, was wir haben oder können oder vielleicht einfach nur wollen. Aber unterm Strich stellen wir unser Inneres zur Schau. Und diejenigen, die vorher auswählen, sprich nur die getunte Version von sich zeigen, weil sie vorgeben, nicht alles preisgeben zu wollen, sind vielleicht noch größere Opfer der Darstellungssucht, als der Durchschnitts-Fußballfan, der verwackelte Gröhlbilder zum Besten gibt, bei denen er sich im Vorfeld nichts gedacht hat.
Untertauchen wird immer schwerer, je leichter es ist, einer Masse aus wahllos zusammen geaddeten Menschen sein Haus, Auto und Boot zu präsentieren. Die Darstellungssucht eines jeden ist das Problem, sei sie auch bei manchen krankhaft und bei anderen kaum ausgeprägt. Aber sie ist da. Und diejenigen, die vielleicht gar nicht darunter leiden, sind oftmals diejenigen, die im kleinen Kämmerlein – ihrer privaten Infozentrale – hocken und allerdings ganz genau wissen, was du Samstag Abend gemacht hast. Sehen und gesehen werden.
Wer also weiterhin ab und an mal untertauchen will, der muss das wohl kommunizieren. Und bei der Absage einer anderen Verabredung zur guten alten Ehrlichkeit zurückgreifen.
Foto: Anika Landsteiner